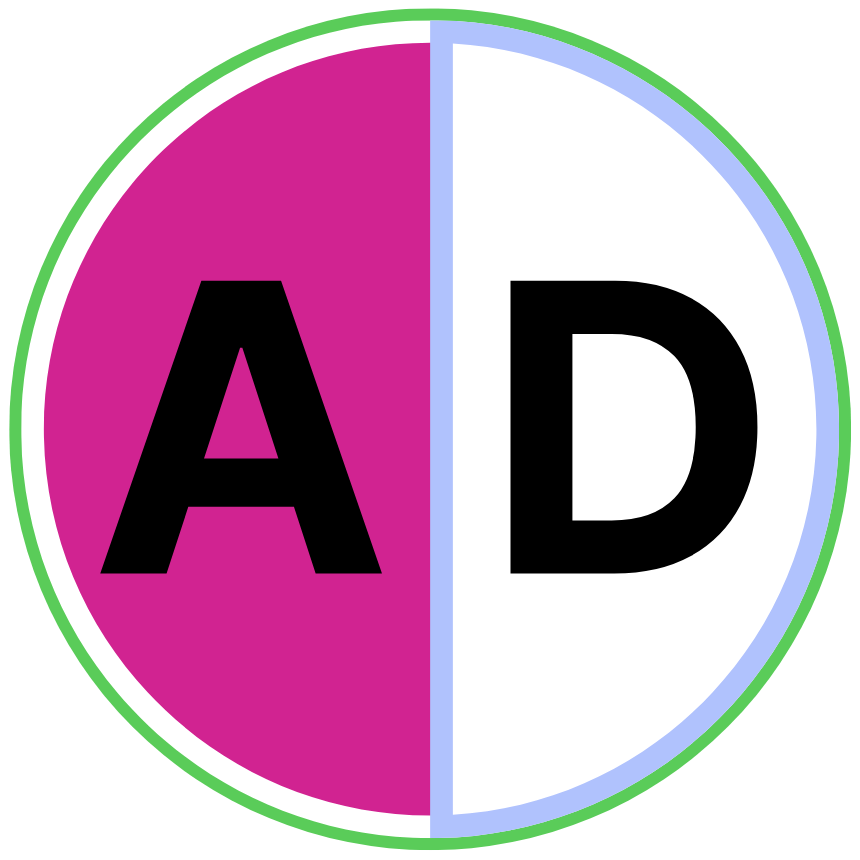Freder sitzt auf der Terrasse seines Hausboots in der Uckermark, das ihm für den Sommer als Künstlerresidenz zugelobt worden war. Er schaut auf die glatte Oberfläche des Sees. Violette und rosa Wolkenschichten türmen sich über dem Horizont. Die Sonne steht bereits tief und blinzelt weiß durch die Schatten eines angrenzenden Eichenwaldes. Freder skizziert mit Pastellkreide die Farben, die vor ihm am Himmel entstehen. Das „Tok-Tok“ seiner Kreide und ihr raues Schaben auf dem grauen Karton sind eine Wohltat für seine Ohren, und er fühlt, wie seine Seele sich mit der der Zeichnung vereint. Der Wind rauscht in den Pappeln zu seiner Linken, das Schilf knistert geheimnisvoll. Freder ist stolz auf sich und seinen Tag. Er hat heute an der Rückseite des Hausboots ein paar großformatige Sonnenuntergänge gemalt. Und wieder werden die Kritiker sagen, er könne nicht malen. Doch einige werden einräumen, dass er diese Werke „Deutsche Sonnenuntergänge“ genannt habe, mache sie zu großer Kunst. Und der Rest der Kunstwelt wird sich dieser Meinung anschließen müssen. Wäre dem nicht so, säße er jetzt nicht hier. Er liebt den sogenannten „schlechten Stil“, und er kann keinen anderen, und er hat damit am Ende noch immer fast jeden beeindruckt.
Er hört ein Auto parken. Es poltert hinter ihm am Nachbarsteg. Freder springt auf und geht an Land. Er sieht eine junge Frau in kräftigen Schritten zu ihrem Boot ausschreiten, sie hat eine Axt und eine Kettensäge geschultert. Ihre Haare in der Farbe des Schilfs steigen bei jedem Schritt auf und ab. Das also ist die zweite Künstlerin in dieser Hausbootresidenz. Der See kräuselt sich von einer Windbö. An Nacken und Armen stellen sich Freders Häärchen auf. Er hat vermieden, sich im Vorhinein nach ihrem Namen zu erkundigen. Er möchte unvoreingenommen sein. Hier und da gluckst und platscht es im Wasser. Freder ist zu sehr Städter, um ausmachen zu können, welches Tier sich da meldet, oder ob es einfach nur die schweren Gummistiefel der forschen Künstlerin sind, die den Steg zum Vibrieren bringen. Im Kasernenhofschritt läuft sie immer wieder die Planken zu ihrem Hausboot hinauf. Sie bringt neue, skurrile Geräte: Seile, Planen, mehr Äxte, Sägen. Ihr Hausboot müsste jetzt schon so proppenvoll sein, dass sie sich nicht einmal mehr auf’s Bett legen kann. Aber wahrscheinlich braucht sie das Alles für ihre tägliche Inspiration. Bisher hat sie ihn noch nicht bemerkt. Doch da plötzlich – auf dem Rücken trägt sie eine Ladung Hämmer – trifft ihn ihr Blick. Finster nickt sie ihm zu. Er betritt wieder das Ufer. Sie verschwindet in einem in Tarnfarben gestrichenen Lieferwagen, und als sie sich gerade daran macht, eine Tischkreissäge von der Ladefläche in Richtung Rampe zu schieben, tritt er auf sie zu und stellt sich ihr vor. Sie reicht ihm lässig die abwärts hängende Hand, als würde sie ihn zu einem Handkuss auffordern. Nein, darauf würde er nicht reinfallen. Er wusste, er durfte diese Hand nicht küssen, sonst wäre er in Kürze Deutschlands Me-too-Lüstling Nummer Eins. Er dreht also ihre Hand sanft nach außen und erhält daraus einen kräftigen Händedruck. Sie stellt sich ihm als Valentina vor. Er ist erleichtert, dass sie ihm ihren Nachnamen nicht nennt. So können sie bei Null anfangen, und für die Tage dieser Residenz die besten Freunde sein.
Geht es Dir auch manchmal so, dass Dir ein Buch empfohlen wurde, und Du musst es nach wenigen Seiten weglegen, weil darin ein eisiger Wind weht, obwohl die Geschichte im Sommer spielt? Mir ging das schon manchmal so, und ich habe dann bemerkt, dass die armen, gepeinigten Protagonist*innen in diesem Fall oftmals auf einer Art leerer Bühne agieren mussten. Die Autor*innen hatten vergessen, eine Atmosphäre zu zeichnen: Wetter, Umgebung, die Einrichtung eines Zimmers, die die Protagonistin und ihren inneren Zustand hätten charakterisieren können. Denn wenn die Atmosphäre, das Wetter, der Ort liebevoll gezeichnet sind, dann fühlen wir uns als Leser*in schon einmal um-geben und gut darin aufgehoben.
Eine andere Diagnose für eine mögliche kalte Leere in einer Geschichte kann sein, dass wir das, was wir sagen wollten, zu sehr von Außen beschrieben haben. Sollte das so sein, dann lohnt es sich, die Szene gründlich umzudoktern und ins Szenische zu ziehen. Das heißt, wir lassen die Figuren handeln, lassen sie in Dialogen miteinander sprechen. Wir lassen die Protagonist*in fühlen, riechen, schmecken, hören und sehen.
Ein letzter Grund für arktischen Wind an einem karibischen Strand kann sein, dass unser Stil zu wenig poetisch ist oder nicht literarisch genug, sondern vielleicht eher ein wissenschaftlicher Stil mit vielen -heit,-keit,-ungs und sowieso zu vielen Substantiven. Unser Text spricht dann vielleicht zu sehr den Geist und nicht so sehr die Seele an. Verlege Dich dann mehr auf Verben und einfache, aber sprechende Worte. (Foto: Manue Garbe)
Wenn Du magst, kommt hier Deine Schreibaufgabe: Schreibe die Geschichte, die ich am Anfang dieses Blogbeitrags begonnen habe, fort. Versuche dabei, die Personen in der Geschichte immer wieder durch die umliegende Natur, die eventuell auftauchenden Kunstwerke oder die Innenräume zu charakterisieren zu lassen. Lass das Innere sich im Äußeren spiegeln!
Wenn Dir das zu komplex ist, dann such Dir ein Naturphoto aus Deinem Fotoalbum oder Lieblingskalender und beschreibe detailliert, was Du darauf siehst. Versuche, die Atmosphäre darauf in Worten wiedererstehen zu lassen!