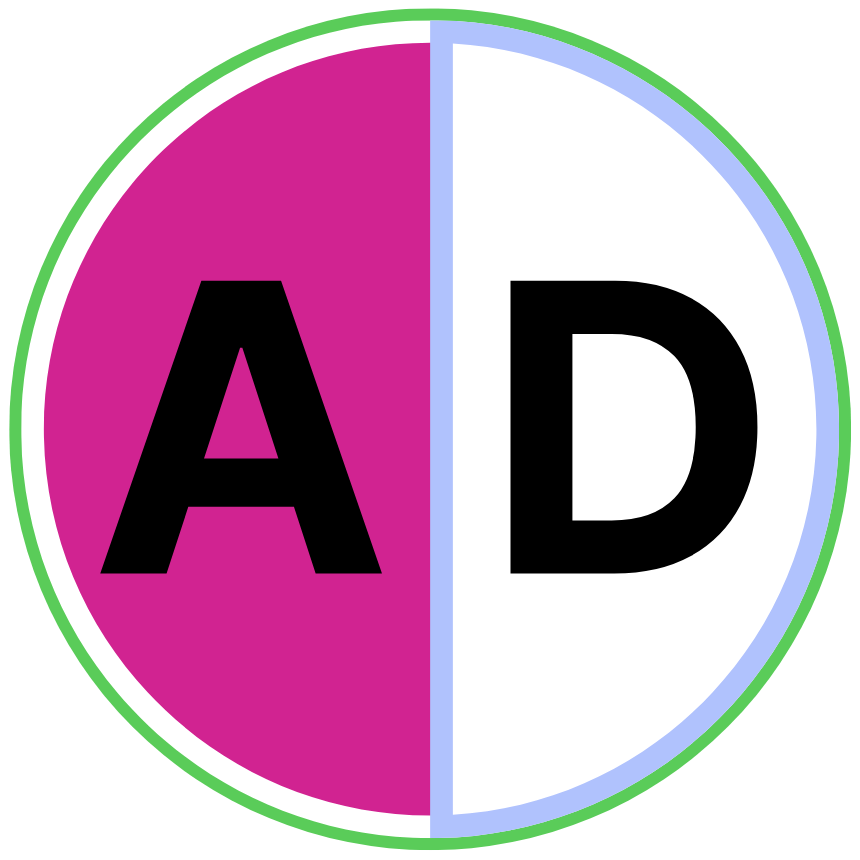Als meine Tochter drei Jahre alt war, bin ich mit ihr in ein großes Second-Hand-Kaufhaus gefahren. Sie hatte vor noch nicht allzu langer Zeit sprechen gelernt, und das war unsere erste gemeinsame Shoppingtour. Meine Tochter schien das Einkaufen in einem solchen Laden schon in einem anderen Leben erlernt zu haben. Sie war so winzig, dass sie mir gerade erst bis zum Oberschenkel reichte, aber sie zog unermüdlich Kleider aus den Reihen und Kisten hervor und rief begeistert „Das ist das Richtige für dich Mami! Wie gefällt dir das hier, Mami? Das sieht toll aus, schau dich mal im Spiegel an!“ Zwischendurch suchte sie für sich selber jede Menge Röcke, T-Shirts und Hosen aus. Ihre Begeisterung steckte mich sofort an, und ich brachte es kaum übers Herz, ihr hier und da ein Nein zu ihrer Auswahl zu sagen. Ich überredete sie nur manchmal, sich für etwas Anderes zu entscheiden, das haltbarer war oder etwas größer. Zuletzt wählte sie ein hellblaues Prinzessinnenkleid, einen Traum aus Tüll und Seide, mit Petticoatrock und einer Schleppe. Sie hat es in den vergangenen sieben Jahren immer wieder getragen, um sich in die Prinzessin zu verwandeln, die sie ohnehin schon immer war und ist. Überaus beglückt und rundum neu eingekleidet verließen wir mit großen, knisternden Taschen das Kaufhaus.
Als meine Kinder noch kleiner waren, fehlte mir als allein erziehender Mutter häufig die Gesellschaft von Erwachsenen. Die Kinder waren so dicht an mir dran, sie waren eine Frucht aus meinem Innern und soeben erst aus meinem Bauch gekrabbelt. Es fühlte sich an, als wären sie mein verlängertes Ich, ein Mini-Me, wie meine Schwester es nannte. Wenn ich mit ihnen zusammen war, so viel Freude mir das auch bereitete, war ich auf irgendeine Weise immer nur mit mir selbst alleine, denn sie waren noch kein Gegenüber. Sie sprachen das nach, was ich sagte, und lebten dabei doch in ihrer eigenen, zauberhaften Welt. Sie zeichneten betörend und bauten und arrangierten Wunderwelten aus all den Sachen, die sie in der Wohnung und in ihrem Kinderzimmer fanden. Sie waren seltsame, traumhafte Wesen, die in einer Zauberwelt lebten, aus der heraus sie mich gelegentlich sehr inspirierten. Wenn ich mit ihnen auf der großen Matratze im Kinderzimmer saß und Zeichenkarton und Stifte um uns herum ausbreitete, dann zeichneten sie munter drauflos: meine kleine Tochter vielleicht ein wildes Krikel-Krakel und mein Sohn einen Vampir. Mir fielen, während sie zeichneten, wunderbar fantastische Dinge ein, Knallbuntes, das ich dringend zu Papier bringen mochte. In solchen Momenten waren sie meine Verbindung mit dem Reich der Phantasmagorien.
Als Schriftstellerin lebe ich nur zur Hälfte in der Welt des Realen, denn ich bin zur anderen in der Welt der Phantastischen zuhause. Die Kunst besteht darin, diese beiden Welten miteinander zu verbinden.
Meine Kinder wachsen immer mehr in diese tatsächliche, logische Welt der Erwachsenen hinein. Manchmal geht ihnen dabei das Künstlerische verloren, und manchmal können sie sich die Verbindung dorthin bewahren. Jetzt, wo sie größer werden, wachsen sie zu einem richtigen Gegenüber heran und wir nehmen mehr und mehr Anteil an einander Leben: wir bewegen uns buchstäblich auf Augenhöhe. Deswegen fühle ich mich mit ihnen nun nicht mehr allein, denn ich genieße unseren reichen Austausch.
Wenn mir beim Schreiben Figuren in den Sinn kommen, dann befinden sich diese zunächst in einem Nebel, und ich habe nur ein Gefühl, ein intuitives Bild von ihnen. Sie sind wie ein Kind in meinem Bauch, zugleich vage und doch sehr real. Manchmal ist es der Name, der der Figur Konturen gibt. Ein anderes Mal muss ich lange nach dem Namen suchen und ihn später sogar, wenn die Geschichte schon weit fortgeschritten ist, noch einmal ändern.
Bei meinen Kindern habe ich das Gefühl, dass sie sich während ihres Wachstums selbst erfinden. Es ist ein komplexes Weben und Schweben. Gleichzeitig sind sie in ihrem Wesen eng mit mir verbunden. Auch meine Romanfiguren sind – wie meine Kinder – eng mit mir verwandt. Sie teilen Passagen meiner Biografie, meiner Neurosen und seelischen Bedrückungen, aber sie sind auch stark und eigenwillig. Sie reagieren – wie meine Kinder – auf mich, sie wachsen über mich hinaus.
Familienmitglieder entwickeln sich oft komplementär zueinander. Wenn das eine Kind durch seine Fröhlichkeit und Scherze die Stimmung in der Familie aufhellt, dann neigt das andere Kind vielleicht zum Grübeln, ist manchmal schwermütig, oder auch aggressiv. So wie es keine zwei gleichen Kinder in einer Familie gibt, so kann auch eine Geschichte keine zwei gleichen Charaktere gebrauchen. Denn die Charaktere in einer Geschichte ergänzen sich komplementär, so wie die Mitglieder einer Familie.
Wenn Du magst, kommt hier Deine Schreibaufgabe: Lege die Figur eines Kindes an! Versuche, so viel kindlich Unlogisches wie es geht, mit hineinzubringen. Spüre so viele Versatzstücke jener kindlichen Zauberwelt in Dir auf, wie nur möglich. Versuche, Dich in die Zeit hineinzuversetzen, als Du drei Jahre alt warst (beziehungsweise in dem Alter, das Du Dir für „Dein Kind“ ausgesucht hast). Versuche solche Sätze zu schreiben, wie Du sie damals gesagt hättest. Versuche, die Umgebung Deiner Kindheit wiedererstehen zu lassen. Dann schaue aus Deinem Fenster. Nimm einen Ort, der Dir dort ins Auge fällt, als Schauplatz für Deine Geschichte und als Erwachsenen einen Lieblingserwachsenen aus Deiner Kindheit: vielleicht Deine Oma, Deinen Vater, einen Lieblingslehrer oder eine Patentante. Überlege, wer der Antagonist sein könnte. Das kann eine Person oder ein innerer oder äußerer Widerstand sein. Lass Dein kindliches Ich mit diesem Lieblingserwachsenen ein Gespräch führen, lass die beiden gemeinsam etwas erleben und gegen den inneren oder äußeren Widerstand/die Antagonist*in antreten! Schreib eine Geschichte!