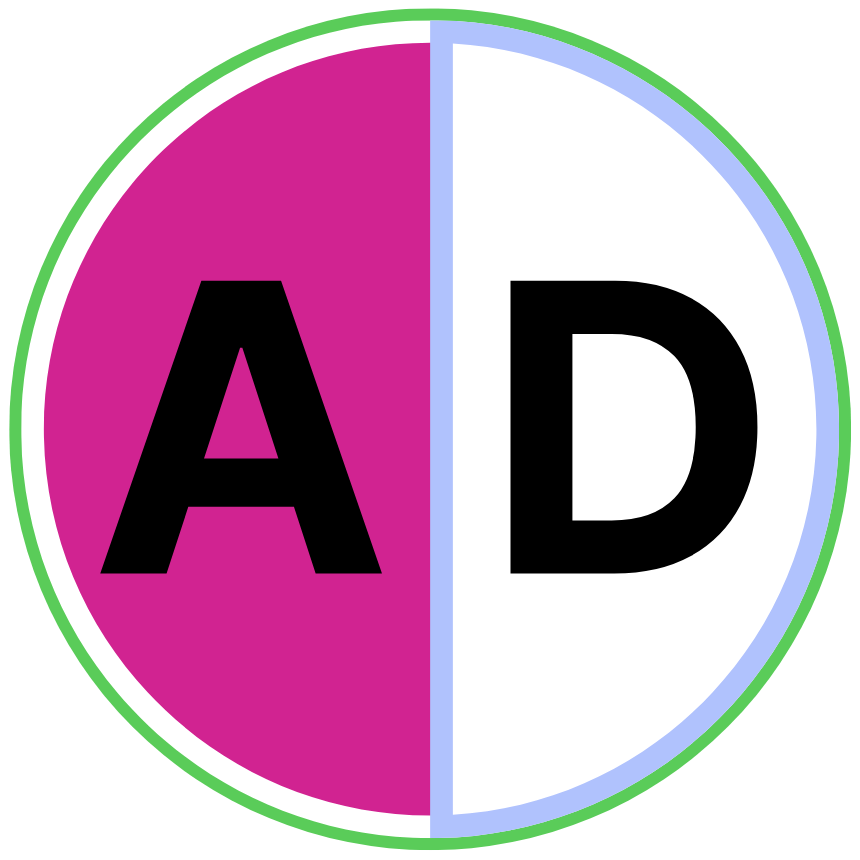Wenn ich als Kind bei meiner Oma in ihrem kleinen Dorf in der Uckermark zu Besuch war, betrat ich morgens immer die bis zur Fadenscheinigkeit abgewetzte, jedoch wunderbar nach Pfefferminz duftende Küche. Ich umarmte meine Großmutter, die rund und lieb und unfassbar weich war. Sie begrüßte mich in ihrem singenden Ostpreußisch und fragte, ob ich ein Ei-chen zum Frühstück haben wolle, eines von glücklichen Hühnern.
Ich setzte mich auf die Bank hinter dem wachstuchbedeckten Esstisch und schaute ihr dabei zu, wie sie Kohlen und Holz in die Luke der Kochhexe warf. Das Scharnier quietschte und Oma tat das Alles, Alles sehr bedächtig. Heute würde das „Achtsamkeit“ heißen. Sie ließ mich an dem Thymian und dem Borretsch schnuppern, den sie für den Tee gepflückt hatte. Sie legte ein rohes Stück Schweinfilet auf den Arbeitstisch, der gleichzeitig ein Spültisch war, und erklärte ausladend, wie sie mit der Konsumfrau Elli um das beste Stück Fleisch gerungen habe und wie sie den Schweinebraten marinieren und zubereiten werde. Das Rezept stamme von ihrer Mutter, die sogar Kenntnisse der französischen Küche besessen hatte und deren Kunst, schmackhafte Soßen zuzubereiten, auf dem Gut Schwesternhof nahe Königsberg damals sehr geschätzt wurde.
Ich lauschte gern der perlenden Melodie ihrer Stimme. Sie erzählte manche Geschichten immer wieder, zum Beispiel die ihrer Flucht aus Ostpreußen Anfang des Jahres ’45. Zum Glück erzählte sie mir diese Geschichte mit immer neuen Variationen so, dass es mir nie langweilig wurde.
Was ich besonders liebte, war, dass meine Oma mir nie vorschrieb, was ich tun oder lieber nicht tun sollte. Sie ließ mich meinen Sommer genießen. Ich lag viel im Mansardenzimmer unter dem Dach oder hockte im Garten, um dort die weltbesten Pfirsiche und Stachelbeeren zu genießen. Manchmal zog ich durch die Hintertür hinaus in den Wald, der einen überwucherten Waldsee, geheimnisvolle Wegesteine und uralte Kiefern und Eichen barg.
Meine Oma unterhielt die Dorfpost und hob dort immer eine „Frösi“ für mich auf, das Magazin „Fröhlich Sein und Singen“, in dem sich Bastelanleitungen fanden, Comics und Geschichten. Sie baute diese Post wochentags in ihrem Esszimmer auf. Einer der zwei großen Speisetische diente dann als Posttheke. An der Wand befanden sich Fächer für Überweisungs-, Paket-, Telegramm- und Lottoscheine. Der zweite Esstisch stand daneben und war mit einem wollenen Tischtuch bedeckt. Darauf legte sie Zeitungen und Zeitschriften aus, das „Neue Deutschland“, die „Sibylle“, das „Neue Leben“ und die „Sowjetfrau“. Die „Sowjetfrau“ war so unbeliebt, dass sie pflichtgekauft werden musste, wenn man zum Beispiel das weitaus beliebtere „Magazin“ erwerben wollte. An ihrem Ofen wärmten sich die Leute morgens, bevor sie zur Arbeit gingen, zogen ein Lottolos und holten ihre Post ab. Alle möglichen Dorfneuigkeiten wurden auf diese Weise in meiner Oma kleine Postzentrale getragen. Und Alles, was sie in der Post erfuhr, trug sie, soweit es nicht vertraulich war, in die entlegendsten Gehöfte, zusammen mit den Briefen, Glückwunschkarten, Rechnungen und Telegrammen.
Die ganze Atmosphäre in dem kleinen, abgewohnten Häuschen meiner Oma war beseelt von ihrer lebensfreundlichen Kraft. Sie war die Sonne, um die alle Familienmitglieder (die sechs Kinder, ihre Enkel und deren Kinder) wie Planeten kreisten. Eine Besondere Rolle kam dabei meinem Onkel Kolle zu: Er war der Mond. In diesem Fall war meine Oma für ihn die Erde. Er hatte unglückliche Liebesgeschichten und konnte sich deswegen nur schwer aus seiner Umlaufbahn um sie herum befreien. So kam es, dass er die meiste Zeit seines Lebens mit ihr zusammen wohnte. Er war ein aufmerksamer Gentleman, der immer mal mit kleinen Bonmots Häkchen an die unendlichen Erzählungen meiner Großmutter setzte.
Man sagt, dass Kinder Sprache nur dann richtig aufnehmen können, wenn Emotionalität mit ihr verbunden ist. Die warmherzige Erzählweise meiner Oma hat auch mir ihre Sprache beigebracht. Meine Oma und ich strickten beim abendlichen Fernsehen und natürlich wusste sie trotz der schwierigsten Muster immer, wer der Mörder war oder wie der Liebesfilm ausgehen würde. Sie selbst erzählte spannend und verband ihre Gedanken immer mit einem melodischen „ohn“, das „und“ bedeutete.
Es gibt Leute, die das Gefühl haben, die Ahnen schauen ihnen aus dem Jenseits zu. Mir geht es so mit meiner Oma. Ich habe das Gefühl, sie schaut mir aus dem Himmel zu und ist stolz auf mich. Das war sie schon damals und das hat mir sehr gut getan.
Wenn Du magst, kommt hier Deine Schreibaufgabe: Trage Gedanken über eine Deiner Lieblingsvorfahr*innen zusammen und überlege, worin sie Dir gut getan haben!