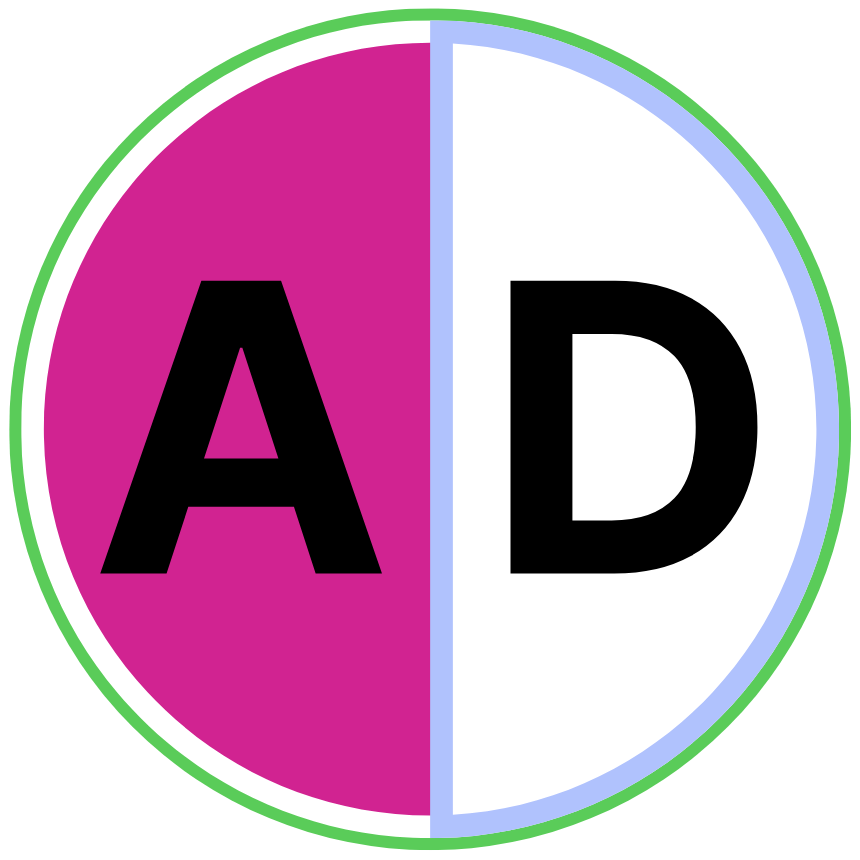Unlängst fuhr ich mit dem Zug durch die Niederlausitz, die nominell meine Heimat ist. An einer Haltestelle namens Teichland mit einem wirklich sehr schönen Teich zur Rechten, zerschnitt zur Linken ein dickes Fernwärmerohr die Landschaft in zwei Teile. Ein patriotischer Spruch war darauf gesprüht, bei dem es um den Plattenbau als die einzige Skyline ging und die Energie als das einzige Wahrzeichen. In so einer schönen, sanften Umgebung mit Teichen, Kiefernwäldern und Wiesen muss man nicht weinen, wenn es keine Skyline gibt, sagte ich mir. Außerdem, so lange sie hier Energie haben, eine von ihrem Herzen ausgehende, starke, strahlende Energie, dann sind sie doch gut aufgehoben. So dachte ich zunächst.
Ich habe wie jeder Mensch eine Heimat, einen Ort, an dem ich groß geworden bin. Er heißt Guben und ist eine polnisch-deutsche Grenzstadt. Dort hatte ich in meiner Kindheit Freund*innen, dort bin ich zum Fotoladen gefahren, um mir Schwarz-Weiß-Passfotos abzuholen, auf denen ich immer möglichst sinister wirken wollte. Dort fuhr ich manchmal ins Dienstleistungszentrum am Neißeufer, um mir einen Stoff plissieren oder Druckknöpfe setzen zu lassen. Dort gab es meinen Lieblingseisladen, in dem ich für gewöhnlich mein ganzes Taschengeld ließ. Er bot nur drei Eissorten an, dafür aber waren Vanille und Schoko von Gourmetqualtität, denn der Eismann verwendete rohe Eier und frische Milch und Sahne.
Dann kam die Wende. Plötzlich konnte ich in aller Freiheit meine Lieblingsschokoladen für eine Mark das Stück erwerben. Gleichwohl war es ein eigenartiges Erlebnis, zu sehen, dass unsere heruntergewirtschaftete Kaufhalle mit den abgeschabten Regalen, plötzlich alle diese perfekten Westprodukte in ihre Auslagen stellte, und nur diese, denn die Ostprodukte wollte keiner mehr haben.
Mit dieser Art der friedlichen Revolution in den Kaufhallen ging auch einher, dass plötzlich alle Reinigungsmittel und Waschmittel ausschließlich aus dem Westen waren. Das hieß, dass die öffentlichen Räume, Bahnhöfe und Schulen, nicht mehr so rochen, wie in meiner Kindheit. Nichts roch mehr so, wie ich es gewohnt war, auch nicht die Wäsche. Bald sah auch nichts mehr aus, wie früher. Hatten wir soeben noch befürchtet, schrecklich zu verarmen und mit der alten Welt zusammen unterzugehen, so wurde um uns herum schon eine neue errichtet. In atemberaubendem Tempo wurde eine Menge alter Gebäude abgerissen, andere wurden renoviert, so dass sie ihren abgerotteten Charme verloren. Es flossen starke Geldströme aus Europa- und aus Aufbautöpfen, so als sei es jetzt das Allerwichtigste, möglichst schnell das Alte zu vergessen.
Das Eis in meinem Lieblingseisladen schmeckte plötzlich nach hunderterlei ausgefuchsten, chemischen Aromen. Mich rüttelte die Angst, dass ich nie mehr in die Heimat, wie sie war, zurückkehren können werde. Dabei liebte und vor allem hasste ich die Kleinstadt, aus der ich kam. Sie kam mir eng vor, und ich wartete schon seit meiner Kindheit dringend darauf, sobald wie möglich ins geistig großzügige Berlin zu ziehen. Hinzu kam die allgemeine Verunsicherung unter uns Ostdeutschen, das Gefühl, dass wir uns mit Nichts mehr richtig auskannten. Dass wir nicht wussten, ob wir im neuen Westen einen Platz für uns finden, oder die armen, bittenden Verwandten bleiben würden.
Ich war so sehr an die schummrigen, abgewirtschafteten Umgebungen meiner Kindheit gewöhnt, die jetzt eine nach der anderen ein neues Plastikoutfit verpasst bekamen, dass es mich dringend nach Ersatz gelüstete. Ich verfiel darauf, so oft es ging, nach Polen oder Tschechien zu reisen, ins Baltikum und nach Russland, um in vor sich hindämmernden Bahnhofscafés einen Tee zu genießen und mich unter den melancholischen Blicken der Einheimischen zuhause zu fühlen. Es war ein exzessiver Verfallstourismus, doch das Schöne war, dass ich auf vielerlei Menschen traf, auf viel Warmherzigkeit und Lebensweisheit. Diese östlichen Menschen waren mir näher, als die neuen Geschwister aus dem Westen.
Während mir Westler vor der Wende, und zwar jeder Einzelne von ihnen, wie nach fremden Seifen duftende Superstars vorgekommen waren, erschienen mir die Unmengen von ihnen, die jetzt durch mein neues Berliner Leben marschierten, wie Snobs, die schon alles wussten und alles schon gesehen hatten, wenn sie nicht gerade notorische Maoisten waren. Doch für gewöhnlich blickten selbst die ein klein wenig von oben auf uns herab.
In meinem DDR-Teenagernarzissmus hatte ich mich immer als etwas sehr Besonderes gefühlt: Ich als Pfarrerstochter mit einer Vorliebe für expressionistische Lyrik und knöchellange Röcke. Jetzt jedoch, im wiedervereinigten Berlin, strömte so viel Andersartigkeit und Individualismus über mich her, dass ich mir wie eine graue Maus auf dem Karneval vorkam, die sich kaum hinaus auf die tosende Straße wagt.
Ich begann, mich für meine Niederlausitzer Heimat zu schämen, denn in ihr wohnten plötzlich eine Menge Neonazis. Es passierten fiese Dinge, die ganz Deutschland erschreckten. Meine Heimat wurde ein sinkendes Schiff, das alle anständigen Leute verließen.
Als ich den Spruch auf der Fernwärmepipeline las, noch ohne das Fußballlogo am Schluss zu beachten, hat er großes Selbstvertrauen und Heimatliebe bedeutet: „Unsere Skyline ist der Plattenbau, unser einziges Wahrzeichen ist Energie.“ Mit dem Fußballwappen von Energie Cottbus dahinter aber bedeutet er nur, dass die Leute statt in den Krieg ins Stadion zu Fußballspielen ziehen um zu sehen, wie sich ihre Heimat mit der der Gegenmannschaften schlägt, und es ist zu befürchten, dass das eine der wenigen Freuden ihres skylinefreien Alltags ist.
Trotzdem habe ich jetzt mehr Vertrauen in meine alte Heimat. Es gibt eine Menge sehr engagierter Menschen, die versuchen, aus dieser Provinz ein blühendes Land zu machen. Die Konzerte organisieren, Krippenspiele und gemeinsame Friedensaktionen mit den Polen auf der anderen Seite der Neiße. Ich merke, wenn ich in die alte Heimat fahre, dass ich mit ihr versöhnt bin und dass ich ihr nicht mehr so grolle. Und es hat sich mein Konzept von Heimat verändert: Heimat ist da, wo ich mit meiner Familie und den Freunden glücklich bin. Und das kann überall auf der Welt sein.
Wenn Du magst, schreibe über Deine alte Heimat. Was für Gefühle ruft sie in Dir wach? Sollten das sehr unangenehme Gefühle sein, dann schreibe diese alle erst einmal auf und erforsche, woher sie kommen. Dann werte die negativen Gefühle in etwas Positives um, schreib Deine eigene Geschichte neu, erfinde sie nach Deinem Gusto! Nun schau, wie Du Dich dabei fühlst und wende diese Methode des Sich-die-eigene-Geschichte-gut-Schreibens immer dann an, wenn Dich die Schwere Deiner eigenen Texte nach unten zieht.