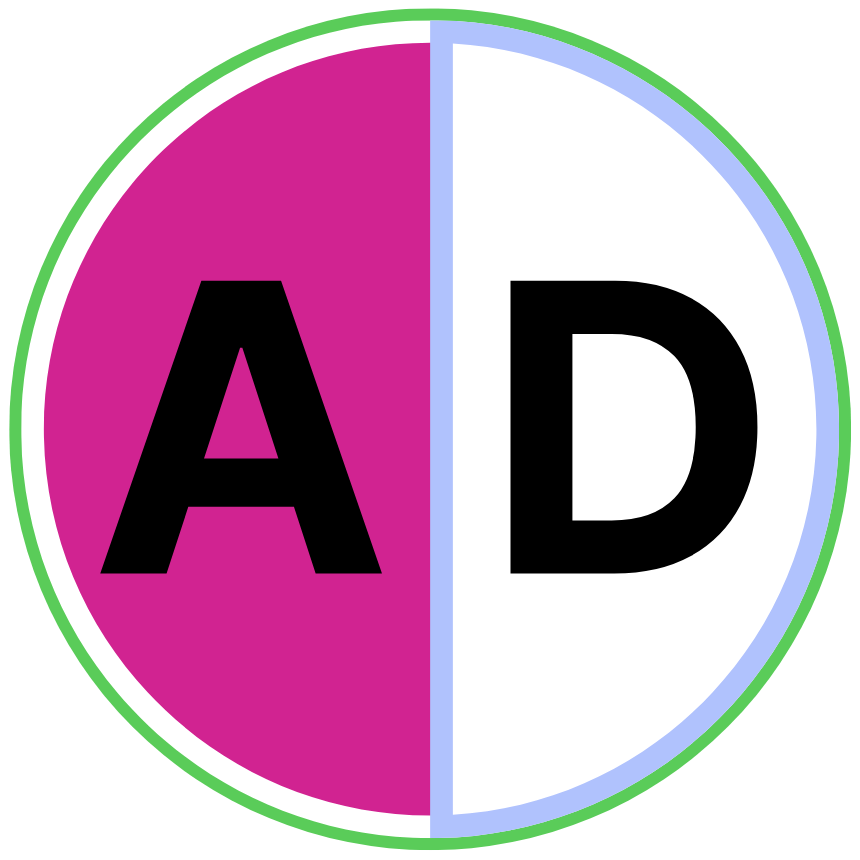Kunst kommt nicht von Können, sondern von Krankheit. Das ist eine Erkenntnis, die mich vor einigen Jahren befallen hat. Künstler*innen können durch die Beschäftigung mit ihrer eigenen Leidenserfahrung ihrem Werk mehr Tiefe verleihen und ihre Leser*innen im Innern berühren. Die künstlerische Arbeit ist oft der Versuch, mit sich selber in Harmonie zu kommen und somit eine Art Therapie, und sie kann sogar eine Therapie für die Leserin werden.
Vor und nach der Geburt meiner Kinder habe ich eine Zeit lang bei jedem Besuch bei meinen Eltern in alten Fotobüchern geblättert und im Keller oder auf dem Dachboden gekramt, um den schwierigen Momenten meiner Vergangenheit und den dunkler schattierten Tagen meiner Kindheit auf die Spur zu kommen.
Dies war die Phase meiner zeltartigen Installationen. Ich glaube, dass wir besonders runde Zelte so sehr mögen, weil sie uns an die Zeit im Uterus erinnern, wo wir so gut aufgehoben waren und die Eltern sich auf uns gefreut haben. Gleichzeitig, so habe ich gelesen, fühlt ein Baby schon im Mutterbauch die Probleme und Verwicklungen seiner Eltern. Weil ich diese fühlte und weil sie doch so wenig greifbar waren, hatte ich das Bedürfnis, die Besucher*innen meiner Ausstellungen in meine Situation zu bringen, sie und mich selber zurück in den Uterus zu katapultieren, um die frühe Kindheit noch einmal zu erleben und alles neu und besser zu machen.
Ich habe außerdem gehört, dass unsere Hormone uns in der Schwangerschaft dazu bringen, uns mit unserer Kindheit und Familiengeschichte auseinanderzusetzen, mit dem, was schwer darin war. Denn die Natur will, dass wir Platz schaffen für das neue Kleine und es nicht übermäßig mit unseren eigenen, mitgebrachten Problemen und Traumata belasten. Das Baby freut sich auch schon, wenn sich Mutter und Vater allein nur mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, selbst wenn es ihnen nicht gelingen sollte, sich von diesen Traumata vollständig zu heilen.
Viele Künstler*innen und Schriftsteller*innen, die ich getroffen habe, haben ein ambivalentes Verhältnis zu ihrer Kindheit und Vergangenheit. Vielen bietet sie eine unerschöpfliche Quelle an neuen Ideen, denn die Schatten der Kindheit drücken und wollen aufgearbeitet werden.
Ich habe einmal eine Geschichte geschrieben über ein sechsjähriges Mädchen, das Gedichte schreibt und dessen Vater und seine Arbeitsfreundinnen diese Gedichte kritisieren und nichts als Verbesserungsvorschläge dafür parat haben. Mir war richtig traurig zumute, als ich diese Passage schrieb, doch ich erinnerte mich an einen Trick, den mir eine befreundete Therapeutin verraten hatte: „Schreib den Text um“, sagte sie, „schreib Dir Dein eigenes Leben so zurecht, dass schwierige Erlebnisse ein Happy End haben“. Ich ließ also in meinem Text den Vater plötzlich auf den Tisch hauen und für sein kleines Töchterchen Partei ergreifen. Das tat so gut, dass mir Freudentränen kamen.
Und hier kommt für Dich eine Aufgabe, die Du am Besten immer wieder umsetzen solltest, um Dir selber etwas Gutes zu tun:
Schreibe einen Text über ein für Dich schwieriges, trauriges Thema. Schreibe Alles ehrlich so auf, wie Du es erlebt hast! Gib dabei Deinen inneren Schmerzen Raum! Dann fiktionalisiere Deinen Text. Gib ihm eine anderes Ende, schreibe ein waschechtes Happy End und spüre in Dich hinein, wie sich das anfühlt!